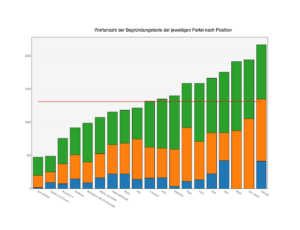Zugegeben, der Titel ist etwas reißerisch. Aber stellen wir uns doch mal vor, der Freistaat Sachsen wäre ein eigenständiger Staat der Vereinten Nationen (UN). Wie würde Sachsen im direkten Demografievergleich abschneiden?
Um das erste Veto zu diesem Vergleich vorwegzunehmen: Ja, es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, eine spezifische Region mit ganzen Staaten zu vergleichen. Denn auch die Vergleichsländer werden sehr wahrscheinlich einzelne Regionen aufweisen, deren Demografie vom Durchschnitt ihres Staates abweichen. Aber: Der nachfolgende Vergleich ist erstens lediglich ein Gedankenspiel, welches die sächsische Altersstruktur vereinfacht ins globale Verhältnis zu setzen versucht. Und zweitens erhält der Vergleich meiner Ansicht nach auch durch die „Staatsgröße“ eine gewisse Substanz: Denn wird die Bevölkerungsgröße der 202 UN-Staaten betrachtet, landet Sachsen mit seinen rund vier Millionen Einwohnern irgendwo zwischen Neuseeland und Georgien auf Platz 131. Ganze 71 Staaten sind also kleiner als Sachsen. Aber kommen wir zum Eigentlichen: Mit welchen Indikatoren wird der Vergleich durchgeführt?
Indikatoren der Demografie: Jugendquotient & Altenquotient
Es ist wohl das ungeschlagene Königsargument aller Alterungsdebatten: „Die arbeitsfähige Bevölkerung finanziert immer mehr Alte“. Und ja, da ist etwas dran. Seinen Ausdruck findet dieser Aspekt im sogenannten Altenquotienten, welcher die Zahl der älteren Bevölkerung ins Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter setzt. Wenn der Altenquotient – wie in Deutschland – kontinuierlich ansteigt, verweist das demzufolge auf die Tatsache, dass der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung immer weiter ansteigt.
Andererseits ist aber auch der Jugendquotient interessant. Mit ihm wird abgebildet, wie viele Kinder und Jugendliche auf 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter kommen. Verkürzt könnten wir mit ihm darstellen, für wie viele junge Menschen die arbeitende Bevölkerung aufzukommen hat und ob der derzeitigen Arbeitsbevölkerung in etwa gleich viele („nachrückende“) junge Menschen gegenüberstehen. Bundesweit sind fallende Jugendquotienten sichtbar.
Beide Schlagwörter sind im politischen Schlagabtausch regelmäßig zu hören, etwa wenn von der zukünftigen Rentenfinanzierung oder der Einwanderung von Fachkräften die Rede ist. Und ja, für kapitalistisch organisierte Ökonomien könnte es tatsächlich eine Herausforderung darstellen, wenn die Arbeitsbevölkerung älter und langfristig kleiner wird. Schauen wir uns deshalb an, was sich für die sächsischen Daten sagen lässt.
Junges Afrika, altes Europa, noch älteres Sachsen
Die nachfolgende Abbildung stellt die Jugend- sowie die Altenquotienten aller Staaten sowie von Sachsen dar. Die linke Skala steht dabei für den Jugendquotienten (15-65 Jahre), wohingegen die X-Achse den Altenquotienten (älter als 65 Jahre) abbildet. Jeder Punkt repräsentiert einen Staat, jede Farbe eine Weltregion.
Wird in der rechten Legende beispielsweise Westeuropa angeklickt, werden in der Abbildung alle westeuropäischen Staaten inklusive Sachsen hervorgehoben. Mit der Shift-Taste lassen sich mehrere Regionen gleichzeitig auswählen. Ein weiterer Klick auf Westeuropa deaktiviert die Auswahl. Die rot eingezeichnete Linie markiert zudem den Jugendquotienten vom Wert 30. Dieser stellt die Bestandserhaltung dar. Befindet sich ein Staat also unterhalb dieser roten Linie, so ist die nachwachsende Generation kleiner als die derzeitige Bevölkerung im Erwerbsalter.1Bei der Bestandserhaltungslinie könnte die Frage aufkommen, wieso diese ausgerechnet den Jugendquotienten von 30 markiert. Der Grund ist: Da hier die Gruppe 0-15 mit der Gruppe 15-65 verglichen wird und beide Gruppen unterschiedlich viele Jahrgänge aufweisen (15 Jahre gegenüber 50 Jahre), muss der Wert, welcher den Bestandserhalt abbildet, an diese Relation angepasst werden. Dabei wird folgende Formel verwendet: (15/50*100)
Was sagt uns die Abbildung nun genau?
Beim Betrachten der Abbildung fällt direkt die kurvenartige Formation der Punktewolke auf: Sie beginnt oben links mit den meisten Staaten des Subsahara-Afrika-Raums. Diese weisen also fast alle einen sehr hohen Jugendquotienten und einen sehr niedrigen Altenquotienten auf. Das heißt, in diesen Staaten ist die nachwachsende Generation so groß, dass sie die aktuelle Bevölkerung im Erwerbsalter (mehrfach) ersetzen kann. Beispielsweise befindet sich Somalia als eines der ärmsten Staaten der Erde in diesem Abschnitt. Wenngleich die Lebenserwartung auch in Somalia in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen ist, sterben die Menschen dort immer noch mit durchschnittlich 56 Jahren. Gleichzeitig weist das Land noch eine im weltweiten Vergleich enorm hohe Geburtenrate auf.
Nach dem Subsahara-Afrika-Staaten folgen Länder aus Nordafrika, Ozeanien, Zentral-/Südasien und Zentralamerika. Westasien erscheint recht diffus verstreut. Südamerikanische Länder und Staaten aus Ost-/Südostasien sind teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der roten Linie, wohingegen karibische Staaten sich tendenziell darunter befinden.
Und ob Nord-, Ost-, Süd- oder Westeuropa – keiner der in Europa liegenden Staaten befindet sich oberhalb der roten Linie. Alle Staaten dürften demnach Probleme haben, ihre arbeitsfähige Bevölkerung durch die nachwachsenden Generationen langfristig zu ersetzen. Deutschland befindet sich innerhalb der europäischen Punktewolke am weitesten rechts unten. Es weist demnach einen vergleichsweise hohen Altenquotienten bei gleichzeitig recht geringem Jugendquotienten auf.
Und Sachsen? Der Freistaat hat mit Abstand die extremsten Werte und befindet sich weit abgelegen von den anderen Punkten. Lediglich 17 UN-Staaten weisen einen noch niedrigeren Jugendquotienten auf als Sachsen (bspw. z.B. Singapur, Italien oder die Vereinigten Arabischen Emirate). Bemerkenswert ist aber vor allem der enorm ausgeprägte Altenquotient: Gemessen an den oben beschriebenen Altersgruppen liegt er im Freistaat bei rund 44, was bedeutet, dass auf 100 Personen im Erwerbsalter rund 44 Personen im Rentenalter (bzw. oberhalb von 65 Jahren) kommen. Kein UN-Staat hat einen derart hohen Anteil an Menschen oberhalb des 65. Lebensjahres bei einem gleichzeitig derart niedrigen Jungendquotienten.
Fazit
Im ersten Blogbeitrag ging ich darauf ein, dass neben den volkswirtschaftlichen Wachstumsraten auch die Weltbevölkerung immer langsamer wächst und immer mehr Regionen sogar eine Schrumpfung aufweisen. Im darauffolgenden Blogbeitrag verwies ich auf die sächsische Demografie und hob hervor, dass der Freistaat eine derartige Region darstellt, seit 1983 schrumpft und lediglich in den beiden starken Zuwanderungsjahren 2014 und 2015 wuchs. Diese beiden Perspektiven habe ich nun zusammengebracht, indem ich der Frage nachging, wie sich die sächsische Bevölkerungsentwicklung im internationalen Kontext darstellt.
Und tatsächlich zeigt sich der Freistaat Sachsen im internationalen Vergleich und gemessen an den beiden Demografieindikatoren des Jugend- und Altenquotienten „rekordverdächtig“: Als eine Gesellschaft, welche den mit Abstand höchsten Altenquotienten aufweist, reiht sich das Bundesland auch beim Jugendquotienten relativ nah am Ende der Rangfolge von rund 200 Staaten ein. Das Arbeitskräftepotential der Zukunft dürfte (sofern die Einwanderung dies nicht ausgleicht) zurückgehen, da die nachwachsende Generation des Freistaats dünner besetzt ist als die derzeitige Erwerbsbevölkerung. Da weniger Menschen sehr wahrscheinlich auch weniger Kinder zeugen werden, könnte sich dieser Trend dadurch aus sich selbst heraus verstärken.
Fraglich ist zudem, ob eine dauerhaft hohe Einwanderung hierfür eine Lösung darstellen kann. Denn woher sollten die bundesweit jährlich notwendigen und gut ausgebildeten 400.000 bis 1,5 Millionen Immigranten langfristig kommen? Immer mehr Regionen stehen vor derselben demografischen Herausforderung. Dadurch werden diese Herkunftsgesellschaften zunehmend versuchen, ihre (auf eigene Kosten ausgebildeten) Fachkräfte zu halten, um dadurch selber abwanderungsbedingte Strukturprobleme zu verhindern. Und wenn sich – wie zu hoffen ist – in den allermeisten Regionen der Erde die Lebensbedingungen weiterhin verbessern werden, könnte es auch sein, dass die Auswanderungsbereitschaft langfristig insgesamt nachlässt.
Sozioökonomische Schrumpfungstendenzen können hochproblematisch sein, da sie das Gegenteil von dem sind, woran wachstumsorientierte Gesellschaften seit wenigen Jahrhunderten ausgerichtet sind. Und wenn die demografische Schrumpfung möglicherweise ein Dauerzustand darstellt und zukünftige Einwanderungstendenzen dies nicht kompensieren, wird es eine wichtige Aufgabe zukünftiger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen werden, wie wir mit diesen tiefgreifenden sozioökonomischen Entwicklungen umgehen und inwiefern die gesellschaftlichen Kosten hierfür verteilt werden. Denn, wie sich heute schon abzeichnet, sind Verteilungskonflikte nicht unwahrscheinlich.
Fußnoten: